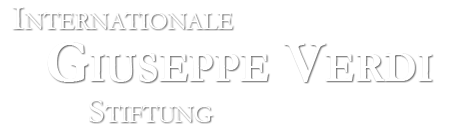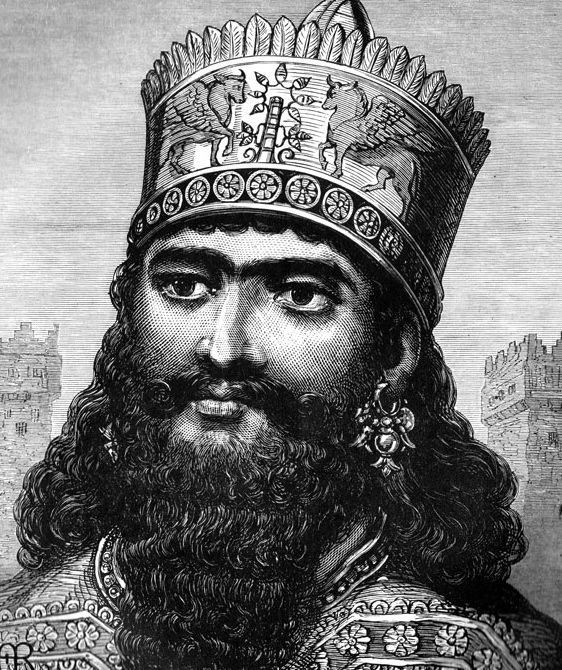NABUCODONOSOR (NACH 1844 NABUCCO)
| Kommentar |
|
|
|
Nabucodonosor ist in erster Linie eine Oper großer Choreffekte. In einzelnen Episoden wird dem Kollektiv von der Qualität des Gesangs und der Erhabenheit im szenischen Kontext her eine der einzelnen Figur durchaus ebenbürtige Bedeutung beigemessen. Zu Recht wird in diesem Zusammenhang auf den Klagechor der Juden („Va pensiero“ III/2) hingewiesen, das berühmteste Stück der Oper, vielleicht von Verdis gesamtem Œuvre. Er ist entschieden einfach gestaltet, formelhaft im Rhythmus, mit gleichförmiger Phrasenbildung und vorwiegend unisoner Textur; gerade aber über diese für einen Chor gänzlich ungewöhnlichen Züge schuf Verdi erst jenes machtvolle Beispiel kollektiven Affekts, das ein nach nationaler Selbstbestimmung strebendes Italien später zum Symbol erheben konnte. Tatsächlich aber steht nicht alles in der Partitur auf diesem Niveau. Als Verdis dritte Oper zeigt Nabucodonosor stellenweise noch Unsicherheit in stilistischer Hinsicht und einen Mangel an Kohärenz. So erweist sich etwa das Terzett im I. Teil „Io t’amava“ als ein farbloses Moment lyrischer Zerstreuung, mit oberflächlicher Verzierung versehen und hier und da einem kunstvollen Kontrapunkt (nicht die einzige Episode der Partitur, in der Verdi seine Beherrschung der „akademischen“ Schreibweise vielleicht allzu eifrig unter Beweis stellt). Im gleichen Zusammenhang wäre auch die schablonenhafte Choreröffnung des III. Teils zu nennen („È l’Assiria una regina“), die einschließlich der Bandainterpolationen vom I. Teil übernommen wurde und in ihrer Orchestration einen frühen Versuch Verdis in der Realisation einer Couleur locale darstellt. Doch bei diesen Stücken handelt es sich um Ausnahmen, aufs Ganze gesehen befinden sich die für Verdis Frühstil essentiellen Elemente in der Balance. Die melodische Kontur bleibt überwiegend unter der Kontrolle einer rigorosen Periodenstruktur, die selbst noch in der Entwicklung verzierungsreicher Passagen zwingende Höhepunkte zu setzen vermag. Dieser Grundzug trägt maßgeblich zur rhythmischen Vielfalt der Oper bei und zeigt einen geschärften Sinn fiir das exakte Tempo dramaturgischer Entwicklungen. Nabucodonosor, dies für Verdi untypisch, enthält keine wichtige Tenorpartie; dafür erweisen sich die Titelfigur (Bariton) als auch Zaccaria (Bass) als Prototypen ihrer Stimmfächer, wie sie Verdi künftig in unverwechselbarer Weise ausprägen wird; Abigaille, aufgrund der extremen stimmlichen Anforderungen eine stets schwierig zu besetzende Partie, eröffnet eindrucksvoll die Reihe amazonenhafter Heroinen, ebenso kraftvoller wie agiler Sopranrollen, die sich für Verdis künstlerische Entwicklung in den folgenden zehn Jahren als so überaus wichtig erweisen sollten. In dieser und manch anderer Hinsicht bezeichnet Nabucodonosor zu Recht den wirklichen Beginn von Verdis triumphaler Karriere als Musikdramatiker. Autors (Bearbeitung Dr. Birgit Schmidt) |
|
Ergänzung oder Erweiterung des Kommentars Sind Sie musikwissenschaftlich aktiv, ein(e) Musiker(in) oder ein(e) Kenner(in) von Giuseppe Verdis Oeuvre und Sie würden gerne den Kommentar zu dieser Oper ergänzen oder erweitern? Bitte nehmen Sie dann Kontakt mit dem Stiftungssekretariat auf. (Klicke dafür hier) |
| Weiter zu musikwissenschaftliche Aufsätzen & Publikationen? (Klicke hier) |