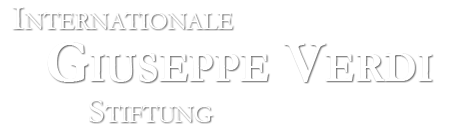ATTILA
| Entstehungsgeschichte |
|
|
|
|
Auf die Stoffvorlage von Attila dürfte Verdi durch Madame de Staels Schrift De l'Allemagne (1810), die bedeutendste Kulturgeschichte der Goethezeit aus französischer Sicht, aufmerksam geworden sein, in der sich neben einem Kurzporträt des von ihr hochgeschätzten Werner auch die eingehende Betrachtung seiner heute vergessenen Tragödie Attila, König der Hunnen findet. In freizügiger Weise verknüpfte Werner darin die historischen Ereignisse des Jahrs 452, als die "Geißel Gottes" nach der Niederlage auf den Katalaunischen Feldern gegen den römischen Feldherrn Aetius die Raubzüge mit der Brandschatzung Aquilejas fortsetzt, bevor er von Papst Leo I. zum Abzug aus Italien veranlaßt wird, mit der Handlung um die burgundische Prinzessin Hildegunde, die Attilas Nähe und Vertrauen nur sucht, um ihren erschlagenen Vater und hingerichteten Geliebten zu rächen. Nach Ernani (1844), der ihn mit dem venezianischen Librettisten Piave zusammenführte, war Attila Verdis zweiter Kompositionsauftrag für das Fenice. Eine vermutlich gemeinsam mit Andrea Maffei erstellte Handlungsskizze, deren Verbleib unbekannt ist, sandte Verdi am 12. April 1845 an Piave. Sie bildete, nach dem Begleitbrief zu schließen, den Grundstock des späteren Librettos und verzichtete bereits auf das bei Werner substantielle Intrigengeschehen am dekadenten römischen Kaiserhof und die Figur der Honoria Augusta, Schwester des noch minderjährigen Kaisers Valentinian. Aus nicht klar ersichtlichen Gründen wurde im Juni die Ausarbeitung des Librettos Piave entzogen und Solera übertragen, der es bis Ende Aug. 1845 fertigstellte, so daß Verdi Anfang September in Busseto die Komposition aufnehmen konnte. Da Solera, der sich in Spanien aufhielt, für Korrekturen nicht zur Verfügung stand wurde mit seinem Einverständnis Piave am 17. November um Huilfe gebeten. Nach den Vorstellungen, die Verdi in diesem Schreiben entwickelte, erfuhr der 3. Akt offenbar derartige Änderungen, dass Solera scharfes Mißfallen äußerte. Durch diese Reaktion nahm die persönliche Beziehung zwischen Verdi und Solera dauernden Schaden, doch Verdis fachliche Wertschätzung des charakterisch schwierigen Librettisten änderte sich nie. Noch im Brief vom 3. April 1861 an Clara Maffei hieß es: "Es ist seine Schuld, daß er keine brillante Karriere gemacht hat und nicht der erste Librettist unserer Zeit geworden ist." Weiter zu Handlung und Libretto? (Klicke hier) |